Die Krisen in den vergangenen Jahren haben insbesondere Kinder und Jugendliche hart getroffen. Psychische Belastungen sowie das Sozial- und Suchtverhalten haben sich laut Studien verschlechtert. Ines Weigelt-Boock vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz im Land Brandenburg ist mitverantwortlich für die Koordination der Landesinitiative ‘Kindeswohl im Blick’. Im Interview spricht sie über Kindergesundheit und welche Verantwortung das Land und die Kommunen tragen, diese zu stärken.
Frau Weigelt-Boock, wie steht es aktuell um die Gesundheit der Kinder in Brandenburg?
Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren schlechter geworden. Das verdeutlichen uns Studien. Beispielsweise hat die in Brandenburg durchgeführte Studie „Corona und Psyche“, oder kurz COPSY-Studie, gezeigt, dass Kinder von der Corona-Bewältigung psychisch sehr belastet waren. In der aktuellen HBSC-Studie wird beschrieben, dass Kinder und Jugendliche mehrmals wöchentlich multiple psychosomatische Beschwerden haben. Insgesamt schätzten 79 Prozent der Befragten ihren Gesundheitszustand zwar als ‚gut‘ ein. Aber im Vergleich zur ersten Studie 2018 haben fünf Prozent weniger ihre Gesundheit als ‚sehr gut‘ oder ‚gut‘ eingeschätzt. Damals waren es noch 84 Prozent. Vor allem wurden häufiger die Symptome von psychischen Erkrankungen genannt, wie zum Beispiel depressive Symptome oder Gefühle der Einsamkeit.
Woran könnte das liegen?
Kinder und Jugendliche müssen momentan sehr viele Herausforderungen bewältigen, wenn wir uns die globalen Krisen der vergangenen Jahre und von heute anschauen. Die Ergebnisse der fünften bundesweiten COPSY-Befragungswelle vom Herbst 2022 zeigen, dass die Hälfte der Befragten nun zusätzlich Ängste und Zukunftssorgen im Zusammenhang mit der Finanz- und Energiekrise sowie dem Angriffskrieg Russlands gegen Ukraine haben. Das sind starke Belastungen sowohl für die Kinder und Jugendlichen, aber auch insgesamt für die Familien.
Wer ist eigentlich…Ines Weigelt-Boock?
Ines Weigelt-Boock ist Referentin im Referat Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik, Gesundheitsziele, Gesundheitsberichterstattung, Psychiatrie des MSGIV. Dort ist sie insbesondere verantwortlich für die Themen Kindergesundheit und gesundheitliche Chancengleichheit.
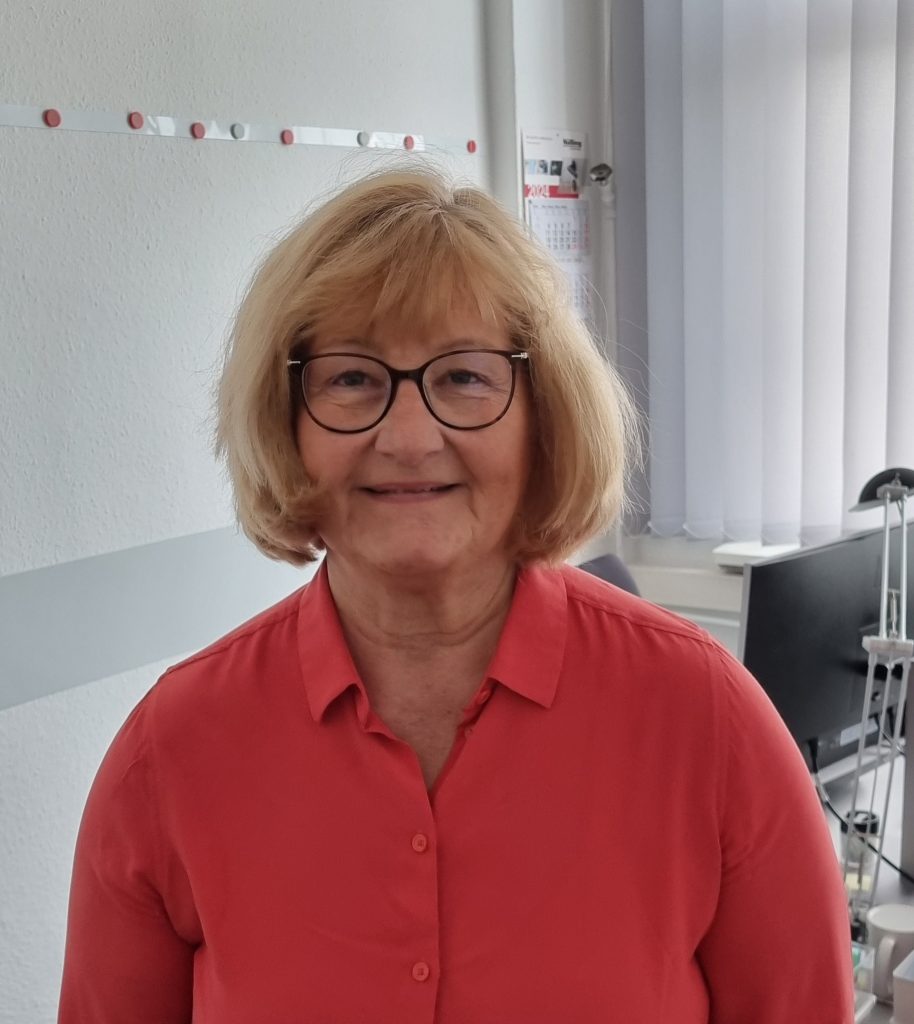
Empfinden Sie diese Ergebnisse als besorgniserregend?
Mit dem Begriff ‚besorgniserregend‘ würde ich zurückhaltend umgehen. Die letzten Jahre waren für Kinder sehr herausfordernd und haben mentale wie körperliche Spuren hinterlassen. Die Heranwachsenden können den Belastungen und Stressfaktoren, denen sie ausgesetzt sind, nicht wirklich ausweichen. Erst die Pandemie-Erfahrungen und jetzt die Kriegsberichterstattungen sind bedrückend. Diese Dinge können Angst und Stress verursachen und machen irgendwann dünnhäutig. Und das wirkt sich auf das Sozialverhalten und auf den Umgang mit Suchtmitteln aus. Die vorliegenden HBSC-Daten zeigen hierzu eine ungünstige Entwicklung.
Die negativen Veränderungen beim Sozialverhalten sind auffällig. Vor allem bei Cybermobbing. So hat sich der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die von Cybermobbing betroffen waren, seit 2018 von zwei auf sieben Prozent mehr als verdreifacht. Zuversichtlich stimmt, dass Kinder und Jugendliche, die über ausreichende Schutzfaktoren verfügen, wie etwa ein gutes Problemlösungsverhalten, Optimismus, soziale Unterstützung und ein positives Familienklima, ein geringeres Risiko für psychische Probleme während der Pandemie hatten. Daraus leitet sich die Aufgabe ab, die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gezielt zu stärken und die Resilienz von Familien zu fördern.
Welche Verantwortung tragen das Land und die Kommunen, wenn es um die Stärkung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht?
Das Land und die Kommunen haben eine gemeinsame Verantwortung, die Gesundheit von Kindern zu stärken. Zu dieser Verantwortung gehört, das Recht von Kindern und Jugendlichen auf ein gutes und gesundes Aufwachsen zu stärken. Dabei geht es beispielsweise um die Bereitstellung von Angeboten, die einen möglichst niederschwelligen Zugang zur gesundheitlichen Versorgung ermöglichen. Dazu gehören regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und Unterstützung bei der Bewältigung von Gesundheitsproblemen.
Die Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern erfordert eine sogenannte ganzheitliche Herangehensweise. Daher sind sozial flankierende Hilfen wie familienunterstützende Angebote, Dienste der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe sowie Unterstützungsangebote für Eltern sehr wichtig. Dazu gehören aber auch Maßnahmen, die in die Alltagsarbeit in Kita und Schule einfließen können, wie zum Beispiel die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, die Stärkung von Selbstwertgefühl und Aufmerksamkeit sowie der Umgang mit Gefühlen.
Es gibt bereits viele Angebote zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Jedoch sind sie nicht überall bekannt oder arbeiten teilweise allein, ohne mit anderen Akteuren fachübergreifend zusammenzuarbeiten. Insgesamt sind sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene Gesamtstrategien wichtig. Prävention und Gesundheitsförderung sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Nur durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit vieler Akteure und mit krisenfesten nachhaltigen Strukturen kann dies gelingen. Die Landesinitiative „Kindeswohl im Blick“ unterstützt den Aufbau und die Stärkung dieser Strukturen.
Wie sind die Kommunen aktuell Ihrer Meinung nach aufgestellt?
Die Kommunen sind unterschiedlich aufgestellt. Die Herausforderungen liegen oft in der Bereitstellung von Ressourcen, im Schließen von Versorgungslücken oder in der Gestaltung verbindlicher Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche. Trotz dieser Faktoren gibt es Kommunen, die gelingende Ansätze zur Verbesserung der Kindergesundheit entwickelt haben. Diese können als Vorbilder dienen und zeigen, wie durch gezielte Maßnahmen die Gesundheit von Kindern verbessert werden kann. Auf der dritten Brandenburger Präventionskonferenz wurden kommunale Aktivitäten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes aus dem Landkreis Oberhavel und aus Potsdam vorgestellt. Themen waren die Weiterentwicklung kommunaler Gesamtkonzepte, welche den interdisziplinären Austausch und gute Vernetzung stärken sollen. Außerdem wurde über Projekte zur Stärkung von Kindern aus suchtbelasteten Familien und mit psychisch kranken Eltern berichtet. Unter dem Dach der Landesinitiative Kindeswohl im Blick wollen wir die bedeutende Schnittstelle zum Öffentlichen Gesundheitsdienst im Feld der Kindergesundheit deutlich machen, um die Kommunen zukünftig noch mehr zu unterstützen.
Hintergrund: Im Rahmen der Studie „Corona und Psyche“ des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf wurde im Zeitraum von Mai bis Juni 2022 eine umfangreiche Online-Befragung zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Für die Studie „Health Behaviour in School-aged Children“ (kurz HBSC) wurden in Brandenburg 3.000 Schülerinnen und Schüler der 5., 7. und 9. Klasse unter anderem zu Themen, wie ihrer subjektiven und körperlichen Gesundheit, ihrem Bewegung-, Ernährungs- und Risikoverhalten und der eigenen Gesundheitskompetenz befragt.
Welche Aufgaben hat die Landesinitiative ‚Kindeswohl im Blick‘?
Die Landesinitiative unterstützt die Gestaltung der notwendigen Rahmenbedingungen im Land und in den Kommunen, um die gesundheitliche Lage bei Kindern und Jugendlichen in Brandenburg zu verbessern. Dabei geht es gewissermaßen um die Stärkung und Entwicklung von Resilienz fördernden Strukturen und Angeboten, damit auch neue belastende Situationen gut bewältigt werden können. Dies soll erreicht werden durch die Weiterentwicklung von Angeboten sowie die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen denjenigen Akteuren und Angeboten, die Kinder und Jugendliche einschließlich ihrer Familien unterstützen, zum Beispiel im Bildungssystem, der Jugend- und Sozialhilfe, der Gesundheitsförderung und in der medizinischen Versorgung.
Wo soll es hingehen mit der Landesinitiative ‚Kindeswohl im Blick‘?
Wir sind dabei, die Vorhaben weiterzuentwickeln. Manche sind schon konzeptionell reifer, andere werden noch auf die Beine gestellt. Überdies ist die Vorbereitung eines Gesundheitspreises zur Kinder- und Jugendgesundheit geplant. Ebenso wollen wir das Unterstützernetzwerk aufbauen, das durch die vorhandenen Gemeinschaftsinitiativen, Netzwerke und landesweiten Projekte in Brandenburg gestaltet werden soll, wie zum Beispiel dem Bündnis Gesund Aufwachsen, der Landessuchtkonferenz, den Netzwerken Frühe Hilfen, Gesunde Kinder und Kinderschutz sowie der Fachstelle für Gesundheitsziele, der Koordinierungsstelle für Gesundheitliche Chancengleichheit sowie der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Letztlich sollen konkrete Maßnahmen in den Kommunen vor Ort ankommen. Die Landesinitiative hat sowohl das Potenzial, die genannten Netzwerke und vorhandenen Landesprogramme in den Regionen als auch viele weitere Programme bei ihrer Arbeit in den konkreten Lebenswelten zu unterstützen und dabei Partnerinnen und Partner wie die gesetzlichen Krankenkassen systematisch einzubinden.






